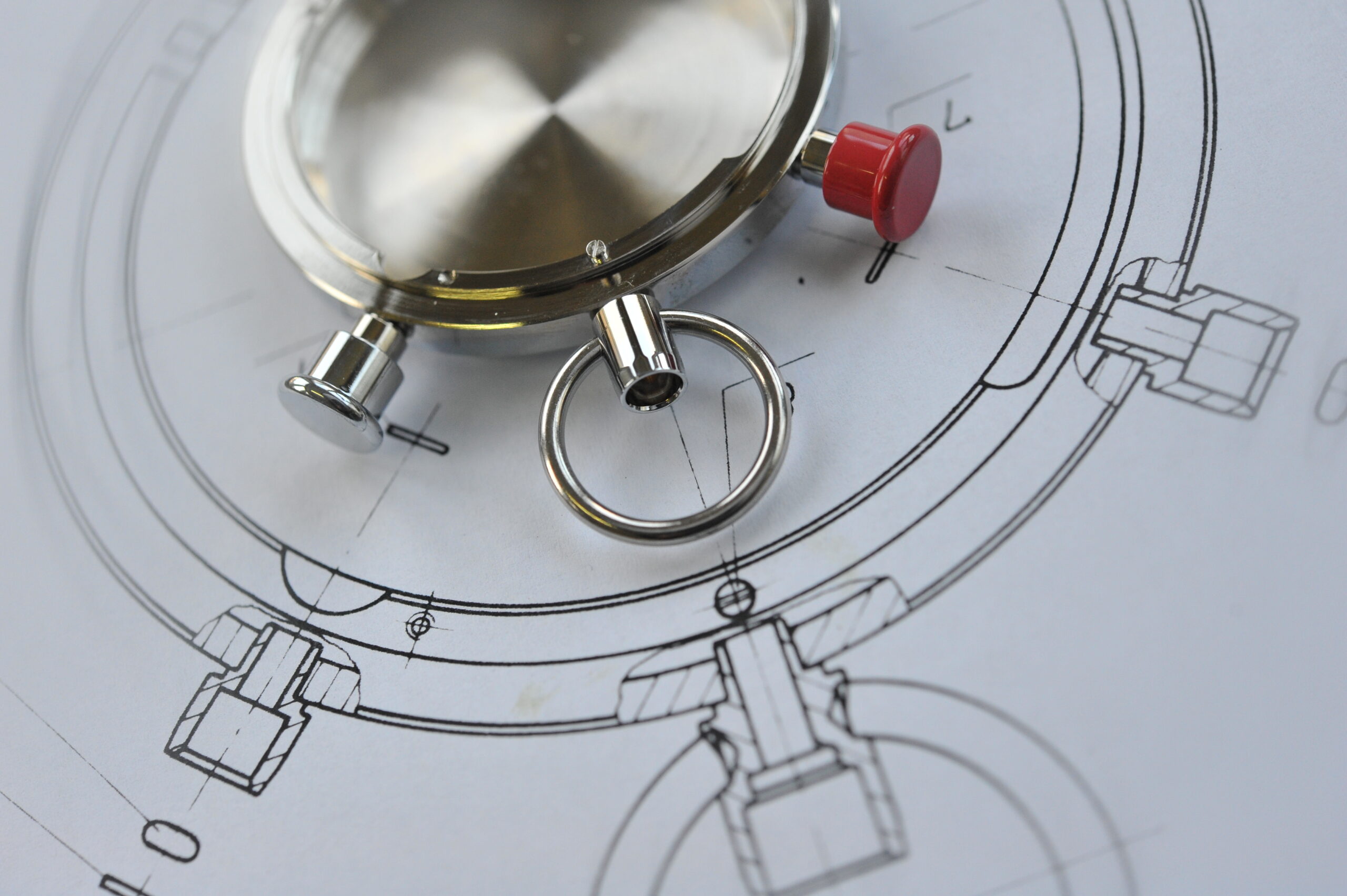“Die Kachel macht den Ofen“
Das Geheimnis des Seelenschmeichlers
Wenn es draußen stürmt und schneit gibt es nichts Schöneres, als aus der Kälte in die warme Stube zu treten. Die Wärme strömt uns aus einem grünen, kantigen Ofen entgegen, die uns mit solch einer wohligen Gemüt-lichkeit umhüllt, dass wir uns sofort heimelig und geborgen fühlen.
„Der Kachelofen ist ein Kulturgut“ erzählt der Kachelofenbaumeister Frank Gehring aus Winden im Elztal. Früher besaß jeder Hof im ZweiTälerLand einen solchen Ofen. Die Stube, in der er stand, war der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Der Ofen wurde stets multifunktional genutzt. Er sorgte für überlebenswichtige Wärme während des kalten Winters, diente als Wäschetrockner, über eine Kachelwand wurde das Schlaf-zimmer gewärmt und es gab ein Fach, in dem Essen warmgehalten und vorm Zubettgehen das Kirschkernkissen fürs Bett aufge-wärmt wurde. Manche Öfen verfügten sogar über ein eigenes Brotbackfach.
„Ein Kachelofen kommt der Wärmestrahlung der Sonne am nächsten“, erzählt Frank Gehring. Das Geheimnis steckt in den Kacheln. „Die Wärmeabstrahlung der Keramik wirkt wie eine langwellige Infrarotheizung.“Zwar brauche der Ofen länger bis er aufgeheizt ist, doch die Wärmespeichermöglichkeit der Kacheln hält bis zu 24 Stunden, erklärt der Fachmann. Die Hitze strömt gleichmäßig ab und führt zu dieser einzigarten Wärme, die uns an den Ofen lockt. Sie geht uns sprichwörtlich unter die Haut, wirkt wohltuend und entspannend. Der Schwarz-wälder Kachelofen ist somit auch etwas fürs Gemüt, ein echter Seelenschmeichler.
„Ofenbauer waren früher die, die das Feuer bändigten“, lacht Gehring. Einst waren es die Hafner, die die Kachelöfen herstellten. Die Kachelmuster waren ihr persönliches Logo. Oft wurden kunstvolle Motive wie Tiere oder Wappen eingearbeitet. Auch abstrakte Muster und Schablonenkacheln mit filigranen Blumenmotiven waren sehr beliebt.Typisch für die Elztäler Kachelöfen ist das Waffelmuster, erzählt Frank Gehring. Noch heute existieren Öfen, die 150 bis 200 Jahre alt sind. Sie werden zu Liebhaberpreisen gehandelt. Stammte die Keramik früher noch aus dem Schwarzwald, aus der Töpfer-stadt Kandern oder Baden-Baden, werden heute die Kacheln überwiegend in Österreich hergestellt. Typisch für die Schwarzwälder Kachelöfen waren dunkelgrüne Kacheln. „Die Farbe strahlte in der Stube Wärme und Be- haglichkeit aus“, erklärt Gehring.
„Wer die Kalte nicht ehrt, ist des Ofens nicht wert!“
Während der Ofen früher als reines Heizgerät seinen Zweck erfüllte, spielt heute die Optik eine große Rolle. Längst hat der Ofen als Designobjekt Einzug in moderne Wohnstuben gehalten, oft mit einem Sichtfenster versehen, das einen Blick auf das prasselnde Holzfeuer preisgibt. Die Wärmeabgabe wird bei modernen Anlagen vollelektronisch gesteuert. Geblieben ist die Wärme, die der Ofen spendet. Und die ist nach wie vor ebenso herzerwärmend wie heimelig ob grüner Kachel-ofen oder High-Tech-Designerofen.

ein Beitrag von
Birgit-Cathrin Duval